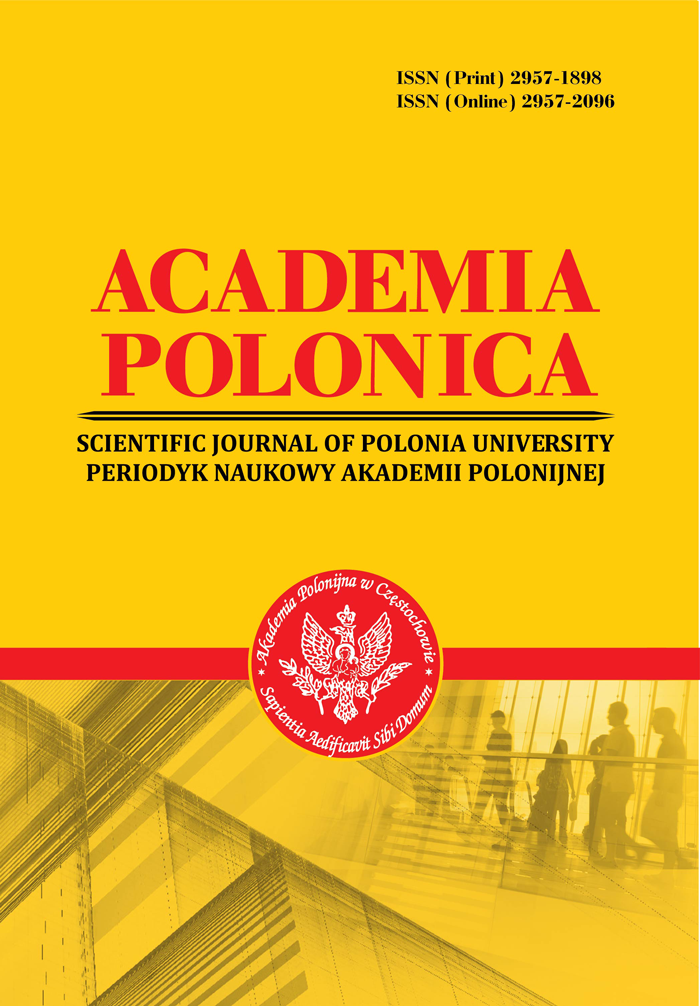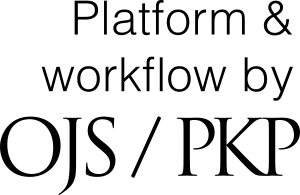FACHTERMINOLOGIE IM DEUTSCHSPRACHIGEN PHILOSOPHISCHEN DISKURS
Abstrakt
Der Beitrag untersucht die sprachlichen Besonderheiten des deutschsprac higen philosophischen Diskurses anhand der Werke von Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Martin Heidegger. Im Zentrum steht die Rolle der Sprache nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern als aktives Instrument der Begriffsbildung und Erkenntnisvermittlung. Die Philosophie greift auf sprachliche Mittel hoher Abstraktion zurück, um komplexe, nicht-gegenständliche Konzepte auszudrücken. Besonders hervorgehoben wird die kreative Neologismenbildung, etwa bei Hegel (z. B. Für-sich-sein, An-und-für-sich-sein) und Heidegger (In-der-Welt-Sein, Seinkönnen), sowie die Umdeutung alltagssprachlicher Lexeme wie Sorge, Möglichkeit oder Dasein.Ein zentraler Fokus liegt auf der semantischen Analyse des Lexems Idee bei Kant und Hegel. Die computergestützte Auswertung zeigt, dass dieses Lexem in beiden Philosophien unterschiedliche Konzepte objektiviert – bei Kant als regulative Prinzipien der Vernunft, bei Hegel als reale Stufen der Selbstverwirklichung des Absoluten. Die Untersuchung macht deutlich, dass philosophische Begriffe häufig autorenspezifisch gefüllt sind und sich der konzeptuelle Raum von einem Denker zum anderen erheblich unterscheidet.Der philosophische Diskurs schafft somit nicht nur neue Inhalte, sondern auch neue Formen sprachlicher Darstellung. Die Sprache fungiert dabei zugleich als Medium, Struktur und Gegenstand des Denkens, was die Analyse philosophischer Texte zu einem besonders ergiebigen Feld linguistischer Forschung macht.
Wykaz bibliografii
2. Schidel R. (2021) Von einer Ethik zu einer Politik der Sorge. URL: https://www.theorieblog.de/index.php/2021/11/von-einer-ethik-zu-einer-politik-der-sorge (Abrufdatum: 01.08.2025)
3. Schulz K., Burkard A. (2024) Die Vielfalt der Philosophie entdecken. Überl egungen zur Diversifizierung des Kanons für den Schulunterricht. Online auf Philovernetzt. URL: https://www.philovernetzt.de/konstruktionsprinzipien/(Abrufdatum: 24.07.2025).
4. Dong-Uhn Suh (2004). Heideggers Wahrheitsbegriff im Hinblick auf „Und-Denken“ und „Ist-Denken“. URL: https://eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/22064a4d-da62-4ebd-84d8-f7782b09634a/content (Abrufdatum: 25.07.2025)
5. Arndt A. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (2003) Handwörterbuch Philosophie. Hg. W.D. Rehfus, Göttingen: Vandenhoek, S. 120–123.
6. Wienbruch U. (2007). Dasein. Historisches Wörterbuch der Philosophie online URL: https://doi.org/10.24894/HWPh.591 (Abrufdatum: 27.07.2025)
7. Hegel G. W. F. (1987) Phaenomenologie des Gestes. Stuttgart: Reclam; Ditzingen, 595 S.
8. Hegel G. W. F. (1984) Wissenschaft der Logik. Bd. 1: Die Lehre vom Sein. Hamburg: Felix Meiner Verlag. 448 S.
9. Heidegger M. (2001) Sein und Zeit. Tuebingen: Max Niemeyer Verlag. 444 S.
10. Kant I. (1900) Gesammelte Schriften. Bd. 3. Berlin: Königlich Preußische Akademie der Wiss., URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k255390/f291.image (Abrufdatum: 29.07.2025).
11. Kant I. (2003) Kritik der praktischen Vernunft. Hamburg: Felix Meiner Verlag. 277 S.
12. Kant I. (1998) Kritik der reinen Vernunft. Hamburg: Felix Meiner Verlag. 995 S.
13. Kant I. (2006) Kritik der Urteilskraft. Hamburg: Felix Meiner Verlag. 633 S.
Abstract views: 0 PDF Downloads: 0